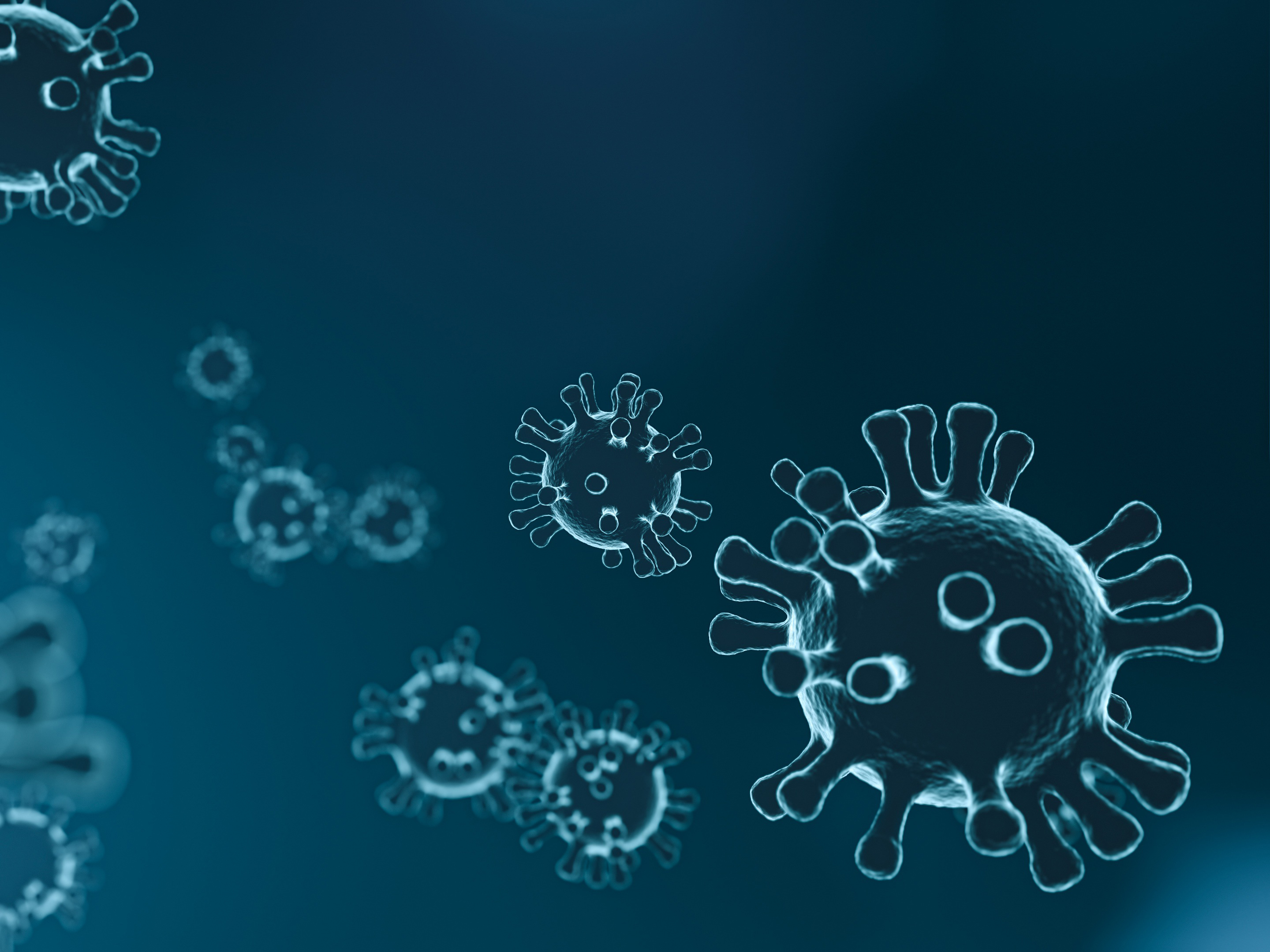Die Bilder von der Versorgungskrise bei älteren Covid-19 Patienten in Italien oder Spanien schockieren: Da heißt es dann in Nachrichten, dass Patienten „nicht mehr geholfen werden könne“und sie „qualvoll ersticken“ Das geht Menschen nahe und erzeugt noch mehr Angst vor dem Corona-Virus, was aber nicht berechtigt sei. „Derartige Schreckensbilder entsprechen nicht der Realität der heutigen Palliativmedizin und sind längst überholt“, betont die Innsbrucker Palliativmedizinerin Elisabeth Medicus im Gespräch mit IMABE. Die Palliativmedizinerin ist u. a. Co-Autorin der Handlungsempfehlung für die Sterbephase bei COVID-19-Erkrankung (23.3.2020) am Landeskrankenhaus/Universitätsklinik Innsbruck.
„Atemnot lässt sich palliativmedizinisch gut behandeln, das ist absolute Routine für uns“, versichert die langjährige ärztliche Direktorin der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft. Ausreichend Opioide stehen zur Verfügung, um das quälende Symptom von „Ich krieg keine Luft“gut dosiert herunter zu regulieren. „Der Stress, der mit der Atemnot verbunden ist, führt dazu, dass der Betroffene noch schneller atmet, wodurch die Symptome nochmals verstärkt werden. Mit Opioiden kann man diesen Teufelskreislaufs durchbrechen. Sie senken den Atemantrieb im Gehirn.“Zugleich helfen beruhigende Mittel gegen die oft mit Atemnot verbundene Angst und Beklemmung. „Niemand muss ersticken“, betont Medicus.
In Krankenhäusern sind diese Medikamente parat, auch mobile Palliativdienste können darauf rasch zurückgreifen. Das sei laut Medicus bei Covid-19 wichtig, da das Virus das Lungengewebe offenbar aggressiver angreift und Patienten rascher als sonst bei einer Lungenentzündung Atemnot entwickeln können. Mit Sorge beobachtet die Ärztin diesbezüglich die erschwerte Lage in den meisten österreichischen Pflegeheimen. „Wir haben es hier mit einem strukturellen Problem zu tun: Die Medikamente sind dort nicht parat, weil Pflegeheime aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen keine Medikamente auf Vorrat haben dürfen. Das ist eine große Lücke im System, das sollte geändert werden.„
Die bisherigen Todesmeldungen zeigen, dass besonders das Immunsystem von älteren Menschen häufig nicht in der Lage ist, das Virus abzuwehren. Für Medicus ist klar: Ob eine Intensivtherapie die im konkreten Fall angemessene Behandlung ist, müssen Ärzte „individuell“entscheiden. „Das war auch schon vor Covid-19 so: Es braucht eine medizinische Indikation, wonach der Nutzen für den Patienten größer ist als der Schaden, ob also die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs stimmt, und ob es dem Patientenwillen entspricht.„ Eine Begrenzung allein durch das Alter komme daher nicht in Frage. „Es gibt auch noch sehr rüstige 80-Jährige mit wenigen Vorerkrankungen, für die so eine Behandlung einen Nutzen bringen kann.“Unverhältnismäßig wäre es, wenn es Patienten, die schon lange bettlägerig sind, nach einer Behandlung auf der Intensivstation noch schlechter geht als vorher und sie das Krankenhaus nicht mehr verlassen können. Eine Entscheidung von „Fall zu Fall“sei nötig. (vgl. auch IMABE-Info: Grenzsituationen in Medizin und Pflege I). Sollte auf Wunsch der Betroffenen bzw. aufgrund einer fehlenden Indikation keine Intensivbehandlung mehr angezeigt sein, spricht man von einer sog. Therapiezieländerung, von der kurativen hin zur palliativen Behandlung: „Wir haben ein breites Handlungsspektrum in der Palliativmedizin: Wenn Heilung nicht mehr möglich ist, bleibt viel zu tun.„
Was die Versorgungsdichte mit Intensivbetten anlangt, ist Österreich im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt. Hierzulande kommen 28,9 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner. Auch Deutschland mit 33,9 Intensivbetten je 100.000 Einwohner und die USA mit 25,8 Intensivbetten je 100.000 Einwohner weisen eine vergleichsweise hohe Dichte auf. Deutlich geringer sind die Kapazitäten in den gegenwärtig besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Staaten Spanien mit 9,7 und Italien mit 8,6 Intensivbetten je 100.000 Einwohner (vgl. Deutsches Ärzteblatt, online, 2.4.2020).