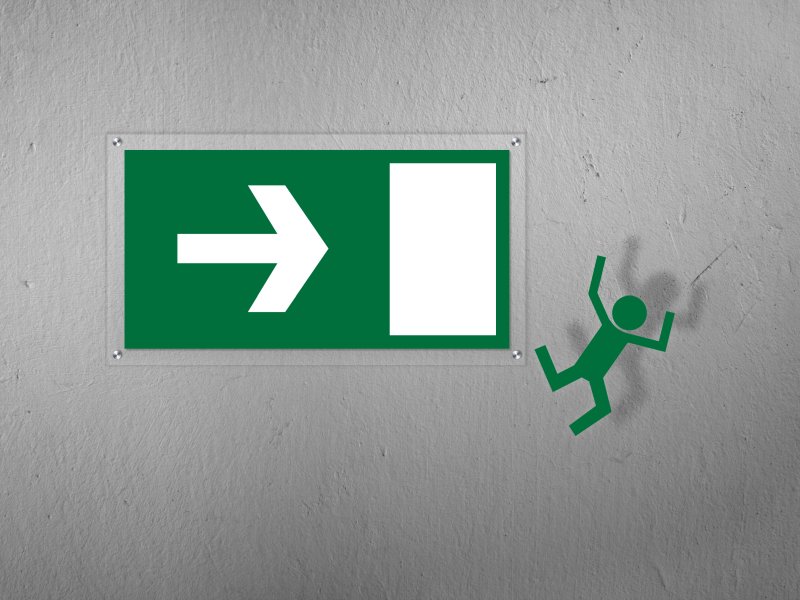Aus Kanada, wo Tötung auf Verlangen und assistierter Suizid (MAiD) seit 2016 erlaubt und ausschließlich unter Mitwirkung von Ärzten praktiziert werden darf, kommen Berichte, wonach das Fachgebiet der Palliativmedizin durch die Gesetzesänderung insgesamt Schaden genommen hat. Vielen Beschäftigte im Gesundheitswesen sind verunsichert. Es scheint nicht mehr klar, wofür Palliativmedizin oder das Hospiz überhaupt stehen. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die in Palliative Medicine (2021;35(2):447-454. doi:10.1177/0269216320968517) publiziert wurde.
Grundlage der Studie waren Interviews mit dem Gesundheitspersonal vor und nach der Gesetzesänderung
In einer qualitativen Befragung von Ärzten und Pflegepersonen untersuchte das Team um Jean Jacob Mathews und Caroline Zimmermann, Vorständin des Departement of Supportive Care des Princess Margaret Cancer Center am University Health Network in Toronto, in wie weit die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe Palliativeinrichtungen verändert hat.
Befragt wurden 13 Ärzte (54% weiblich) und 10 Pflegekräfte (90% weiblich) im Durchschnittsalter von 43 Jahren, die vor und nach der Legalisierung er aktiven Sterbehilfe in Kanada in einer Palliativeinrichtung oder -station gearbeitet hatten. Ab Juni 2016 mussten sie Patienten über die Möglichkeit der aktiven Sterbehilfe aufklären und wirkten dabei entsprechend der gesetzlichen Vorgaben mit.
Neue "Aufgabe" macht dem Gesundheitspersonal zu schaffen
Die im Palliativbereich Tätigen waren sechs Monate vor und sechs Monate nach diesem Zeitpunkt über ihre Einstellung bei der Arbeitsweise interviewt worden. Bei der Auswertung der Themen zeigte sich: Mit Einführung der Tötung auf Verlangen/Assistierter Suizid veränderte sich der Zugang zum Sterben. Als „neue Herausforderungen“ beschrieben die Beteiligten die veränderte Kontrolle der Symptome, die Art der Kommunikation, die persönlich empfundenen Belastungen und die spürbare Verschlechterung des Arzt-Patienten-Verhältnisses sowie allgemein das Aufzehren von Ressourcen durch sog. Sterbehilfe-Fälle. Nach Einschätzung von Dietmar Weixler, Präsident der Palliativgesellschaft in Österreich, beherrscht dieses Thema derzeit die wissenschaftliche Auseinandersetzung in der Palliativmedizin. Bislang liegen nur wenig Erfahrungen vor. Die qualitative Studie zeige einige wesentliche Eckpunkte auf:
Das Sterben wird zu einem "kalten isolierten Weg, die Welt zu verlassen"
Die Erfahrung von Sterben habe sich dadurch entscheidend verändert, dass zu bestimmten positiven Wahrnehmungen beim Sterben eher negative hinzugekommen sind. Das Sterben werde nicht mehr angenommen, sondern es ist zu einem Prozess geworden, der von einigen als ein „kalter, isolierter Weg, die Welt zu verlassen“ beschrieben wurde.
Hilfreiche Schmerzmittel werden abgelehnt, weil sie womöglich die Entscheidungskraft schwächen
Die Befragten standen häufig vor dem Dilemma, dass vor allem Patientinnen, die Tötung auf Verlangen wollten, gleichzeitig starke Schmerzmittel ablehnten, die ihr Leiden hätten lindern können. Sie hatten Angst davor, dass dadurch ihre Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt würde und sie ihr „Recht auf Sterbehilfe“ nicht mehr artikulieren könnten. Für Patient und Arzt ergaben sich daraus belastende Situationen.
Alles kreist um die Bestimmung des Todeszeitpunkts
Es entstanden im Vorfeld neuartige, schwierige Gespräche mit den Patienten. Viele wollen im Gespräch bis ins Detail über den geeigneten Zeitpunkt verhandeln. Das werde im Laufe der Zeit zu einem alles dominierenden Thema. Dadurch entsteht eine neue und große emotionale Belastung – nicht nur für den oder die Betreffende, sondern auch für das Personal. Sie besteht besonders dann, wenn der Todeszeitpunkt vorab festgelegt und bekannt wird. Verbunden ist damit auf beiden Seiten die Angst vor sozialer Stigmatisierung. Gleichzeitig tritt auf Seiten des Personals die Angst vor Gewöhnungseffekten auf wie auch die Furcht vor einer andauernden Mitarbeit bei Tötungen.
Patienten wehren sich gegen den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses
Auch die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten verändert sich. Palliative Care wird nicht mehr als Hilfe in schwieriger Situation wahrgenommen, sondern als eine Angst erregende Tätigkeit, weil sie in Tötungen münden kann. Mediziner und im Gesundheitswesen Tätige erleben damit erstmals in ihrem Berufsleben so etwas wie Widerstände gegen den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Patienten, was bislang nach aller Erfahrung die Grundlage ihres Tuns gegenüber dem hilfsbedürftigen Kranken war.
Ressourcen werden von der eigentlichen Palliativversorgung abgezogen
Institutionell wurde in Kanada die Beobachtung gemacht, dass die vorhandenen Ressourcen, die für die Palliativmedizin vorbehalten werden, automatisch in die Vorbereitungen eines Verfahrens zur Tötung auf Verlangen/Assistierter Suizid hineingelaufen sind. Diese Ressourcen fehlten dann anderswo. Die Abläufe für MAiD würden die reguläre Versorgung von Palliativpatienten beeinträchtigen.
Natürlicher Tod und Tötung durch Dritte sind zwei ganz verschiedene Dinge
Das Prozedere der Verwirklichung von Tötungswünschen wird als speziell und sonderbar empfunden. Dass palliative Patienten Diagnose- oder Therapievorschläge ablehnen, ist ein normales Phänomen, mit dem die Palliativmedizin häufig konfrontiert ist und gut umgehen kann. Die Planung und Durchführung einer Tötung auf Verlangen könne jedoch damit nicht verglichen werden, das seien zwei ganz verschiedene Zugänge.
Zahl der Sterbehilfe-Fälle in Kanada ist in 5 Jahren um das Zehnfache gestiegen
Im 37,6 Millionen Einwohner zählenden Kanada wurden aktive Sterbehilfe und Suizidbeihilfe im Juni 2016 legalisiert. Die Zahl der Betroffene stieg rasant an: von 970 Fällen im ersten Jahr auf 10.064 Fällen im Jahr 2021. Insgesamt haben sich in den fünf Jahren im Rahmen von MAiD 31.664 Kanadier - hauptsächlich durch Tötung auf Verlangen - das Leben genommen. Mediale Berichte zeigen, dass es bereits zu einer Verschiebung im Wertegefüge gekommen ist. So wird ein vorzeitiger Tod als kostengünstigere Option etwa bei Long-Covid-Patienten, Menschen mit Behinderung oder Kriegsveteranen angeboten - auch ohne schwere Erkrankung oder explizitem Wunsch der Patienten (Bioethik aktuell, 6.9.2022).