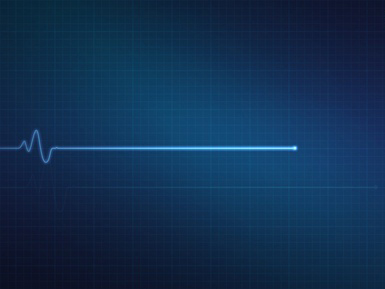Deutschland hat mit dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 das Tor für eine „geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid“ geöffnet. Begründet wurde dies von den Richtern damit, dass es ein Grundrecht auf einen selbstgewählten Tod gebe (vgl. Pressemitteilung Nr. 12/2020 vom 26. Februar 2020). In ihrem Urteil gingen die Richter weiter als erwartet. Das „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen - unabhängig von einer bestimmten Schwere einer Erkrankung. Das Recht gelte für Menschen „in allen Phasen ihres Lebens“, betonte BVerfG-Präsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung. Nun liegt es am Gesetzgeber, Regelungen zu erstellen.
Die Entscheidung der Verfassungsrichter sorgte für heftige Reaktionen seitens der Ärzteschaft. So nahm der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes „mit Bestürzung und Bedauern“ auf. „Das Urteil kann auf lange Sicht zu einer Entsolidarisierung mit schwerstkranken und sterbenden Menschen in unserer Gesellschaft führen“, befürchtet Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des DHPV (vgl. Pressemitteilung, online 26.2.2020). Das Urteil verwundere ihn ferner, da die Richter die Gefahren einer Freigabe der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe nicht infrage stellten. Hierzu zähle, dass geschäftsmäßige Suizidbeihilfe zu einer gesellschaftlichen Normalisierung der Suizidhilfe führen und sich der assistierte Suizid als normale Form der Lebensbeendigung insbesondere für alte und kranke Menschen etablieren könne. Im Ergebnis stelle das Bundesverfassungsgericht aber sein rechtliches Verständnis von Autonomie, Selbstbestimmung und Würde über diese Gefahren. „Besonders schwer wiegt beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Ansicht, dass Suizidbeihilfe nicht nur bei schwerer Krankheit das Recht jedes und jeder Einzelnen sei, sondern in jeder Phase menschlichen Lebens bestehe“, so Hardinghaus.
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) sieht das Urteil in seiner Konsequenz für Ärzte und Psychiater kritisch. Insbesondere Psychiatern drohe in Fragen der Suizidbeihilfe aus Sicht der Fachgesellschaft, eine neue Rolle zuzukommen. Als Gutachter würden sie absehbar darüber entscheiden müssen, inwieweit die Selbstbestimmungsfähigkeit und der freie, uneingeschränkte Wille eines Menschen in Hinblick auf seinen Sterbewunsch gegeben sind. Diesen Rollenwechsel hält die DGPPN für inakzeptabel und hält fest: „Beihilfe zur Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe“ (vgl. Pressemitteilung, online, 27.2.2020).
CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, mit allen Beteiligten sprechen zu wollen, um eine verfassungsgerechte Lösung zu finden (vgl. Süddeutsche Zeitung, online, 28.2.2020). Das Gericht habe dem Gesetzgeber „ausdrücklich einen Spielraum“ gegeben. Als Möglichkeiten, wie der Staat die Sterbehilfe regulieren könnte, nannten die Richter Beratungspflichten und Wartezeiten oder auch einen Nachweis über die Ernsthaftigkeit eines Todeswunsches. Was das im Detail bedeutet, wird zu neuerlichen Debatten führen. Der Schweizer Sterbehilfe-Verein Dignitas hat bereits angekündigt, ab nun seine Dienste für zahlende Mitglieder auch in Deutschland anzubieten.
Der Präsident der Deutschen Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sieht gewährleistet, dass Ärzte aus Gewissensgründen eine Mitwirkung am Suizid verweigern können. „Die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten ist es, unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie Leiden zu lindern und Sterbenden bis zu ihrem Tod beizustehen“, sagt Reinhard in einer Stellungnahme (vgl. Deutsches Ärzteblatt, online, 26.2.2020). „Die Beihilfe zum Suizid gehört unverändert grundsätzlich nicht zu den Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten.“
Aktuelle Entwicklungen in Kanada zeigen, dass der Druck aber von anderer Seite kommen kann: Einem Hospiz in British Columbia, das sich geweigert hatte, die seit 2016 erlaubte Beihilfe zum Suizid und Tötung auf Verlangen anzubieten, wurden sämtliche öffentliche Ko-Finanzierungen gestrichen. Die Vorgaben der Delta Hospice Society entspreche nicht den Compliance-Regelungen, wonach in staatlich mitfinanzierten Einrichtungen Menschen „voller Zugang zu deren medizinischen Rechten gewährleistet“ werden müsse, so die Begründung des Gesundheitsministeriums (vgl. City News, online, 25.2.2020).